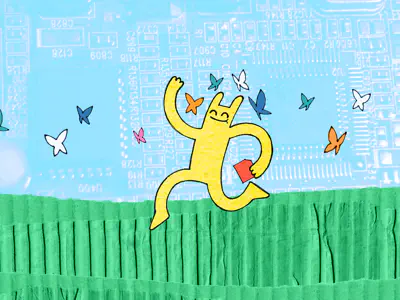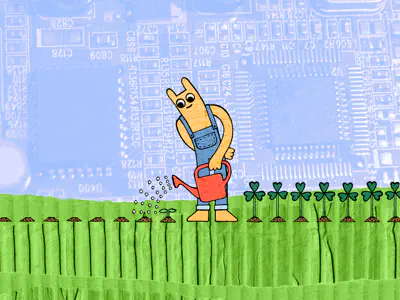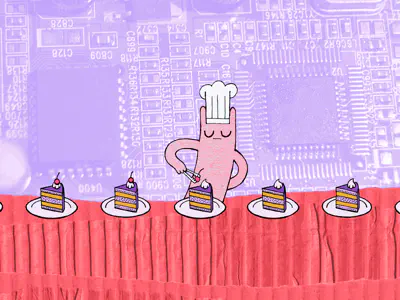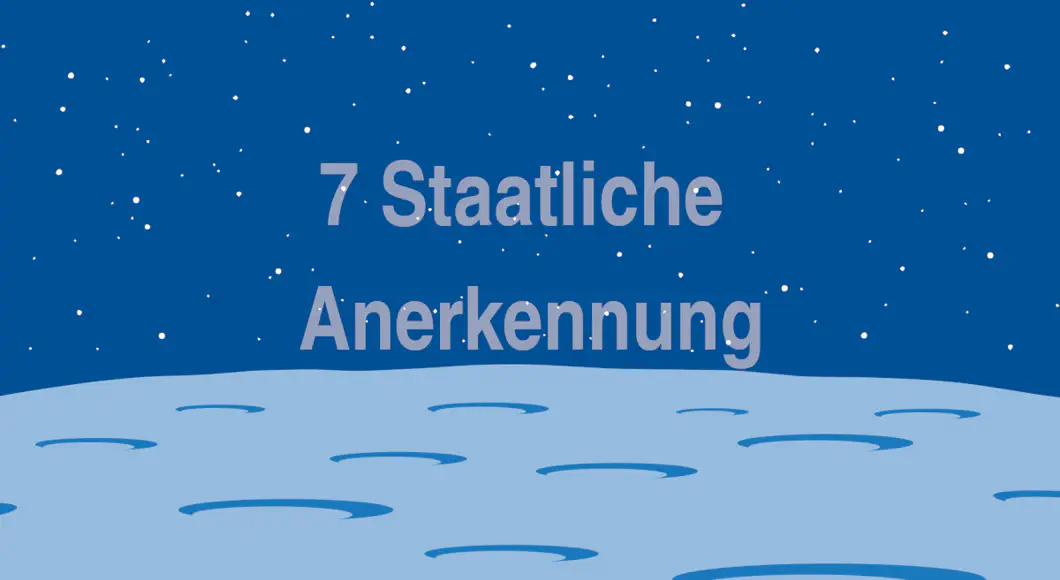
Infrastruktur als Commons oder Wir holen uns das Internet zurück (7)
Wenn wir technische Infrastruktur als Gemeinschaftseigentum verwalten wollen, müssen wir die Prinzipien kennen, mit denen das erfolgreich gelingen kann. Die Politologin Elinor Ostrom hat in empirischen Studien acht Designprinzipien identifiziert, mit denen Commons-Ressourcen erfolgreich verwaltet werden. In dieser Blogreihe stellen wir die Ostrom’schen Designprinzipien vor und wenden sie auf Genossenschaften an.
7. Staatliche Anerkennung
Die staatliche Anerkennung von eingetragenen Genossenschaften ist in Deutschland durch das Genossenschaftsgesetz gegeben. Es gewährleistet den Genossenschaftsmitgliedern das Recht auf Selbstverwaltung, beschränkt dieses Recht aber auch zum Beispiel durch die Pflichtmitgliedschaft in den genossenschaftlichen Prüfungsverbänden. Das Mindestmaß, das Elinor Ostrom einfordert, ist damit gegeben.
Transformatorische Kraft
Staatliche Anerkennung genießt die Commons-Institution Genossenschaft jedoch in erster Linie durch Art. 14 des Grundgesetzes oder im europäischen Kontext durch Art. 17 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union mithin also durch die Gewährleistung des Eigentums in der Verfassung. Die Commons-Ressource, die durch eine Genossenschaft gepflegt wird, ist deren Eigentum. Genossenschaften unterscheiden sich in dieser Hinsicht nicht von Privatunternehmen oder Kapitalgesellschaften, in deren Eigentum sich Produktionsmittel, Immobilien oder andere Vermögenswerte befinden.
Genossenschaften stellen jedoch als demokratisch verfasste Unternehmen das Privateigentum in den Dienst einer Gemeinschaft. Diese Fähigkeit gibt Genossenschaften innerhalb der bestehenden Wirtschaftsordnung eine erhebliche transformatorische Kraft. Sie sind in der Lage, eine zentrale Forderung unserer Verfassung, nämlich die Sozialverpflichtung des Eigentums, in spezifischer Weise zu verwirklichen, nämlich indem sie Privateigentum als demokratisches Gemeinschaftseigentum interpretieren.1
Schwerer Stand in Deutschland
Nicht verschwiegen werden sollte, dass Deutschland kein besonders genossenschaftsfreundliches Land ist. Wir haben dies bereits in unserem Blog beklagt:
»Es gibt in Deutschland, also in dem Land, in dem die Genossenschaftsidee geboren wurde, nur rund 7.500 eingetragene Genossenschaften. In der sehr viel kleineren Schweiz sind es über 8.500. Ermittelt man die Anzahl der Genossenschaften pro 100.000 Einwohner, so ergibt sich eine Kennziffer, die einen Ländervergleich ermöglicht. In diesem Vergleich schneidet Deutschland mit 9 Genossenschaften pro 100.000 Einwohner sehr schlecht ab. In der Schweiz sind es über 99. Wäre Deutschland ein ebenso genossenschaftsfreundliches Land wie die Schweiz, gäbe es bei uns fast 82.600 Genossenschaften, also elfmal so viele.«
Die Situation von Genossenschaften in Deutschland könnte besser sein. Manchmal hat es den Anschein, dass vor allem die öffentliche Hand, Genossenschaften Steine in den Weg legt. So müssen beispielsweise Kommunen, die sich mit vergleichsweise geringen finanziellen Mitteln an einer Genossenschaft beteiligen wollen, die gleichen bürokratischen Prozesse durchlaufen, als wenn sie sich mit mehreren Millionen Euro an einem profitorientierten Energieversorgungsunternehmen beteiligen möchten. Das könnte der Grund sein, warum es die kommunale Selbstverwaltung bisher nicht geschafft hat, in bedeutendem Umfang genossenschaftliche IT-Ressourcen für eine selbstbestimmte Digitalisierung aufzubauen. Stattdessen machen sie sich lieber von privatwirtschaftlichen Unternehmen abhängig oder von landeseigenen Rechenzentren, deren Leistungen sie nur in sehr begrenztem Umfang mitbestimmen können.
Die staatliche Anerkennung von freier Software richtet sich im Wesentlichen nur abstrakt auf die Anerkennung der freien Lizenzen. Freie Software könnte aber auch bei öffentlichen Ausschreibungen bevorzugt werden. Ob hierdurch finanzielle Mittel wirklich zielsicher den Entwicklern freier Software zugute kämen oder lediglich den Unternehmen, die freie Software besonders effizient nutzen, bliebe abzuwarten.
Die Welt der freien Software und der IT-Technik ist groß und komplex, sodass die Frage staatlicher Anerkennung von Commons-Ressourcen bei technischer Infrastruktur besonders wichtig ist. Die Problematik wirft ein Licht auf den nächsten Teil unserer Blogreihe, bei der es um die Vernetzung von Commons-Ressourcen geht.
- Einleitung
- Grenzen
- Kongruenz
- Gemeinschaftliche Entscheidungen
- Monitoring der Nutzer und der Ressource
- Abgestufte Sanktionen
- Konfliktlösungsmechanismen
- Staatliche Anerkennung
- Eingebettete Institutionen und polyzentrische Governance
-
In der Commons-Forschung wird auf das Zusammenwirken von Privateigentum und Allmendenutzung häufig hingewiesen. Eine sehr anschauliche historische Schilderung gibt Hartmut Zückert in ›Allmende: Zur Aktualisierung eines historischen Eigentumsbegriffs‹, in ›Commons: für eine neue Politik jenseits von Markt und Staat.‹ Hrsg. v. Silke Helfrich/ Heinrich Böll Stiftung. 2. Aufl. Bielefeld 2014, S. 158-164 ↩︎